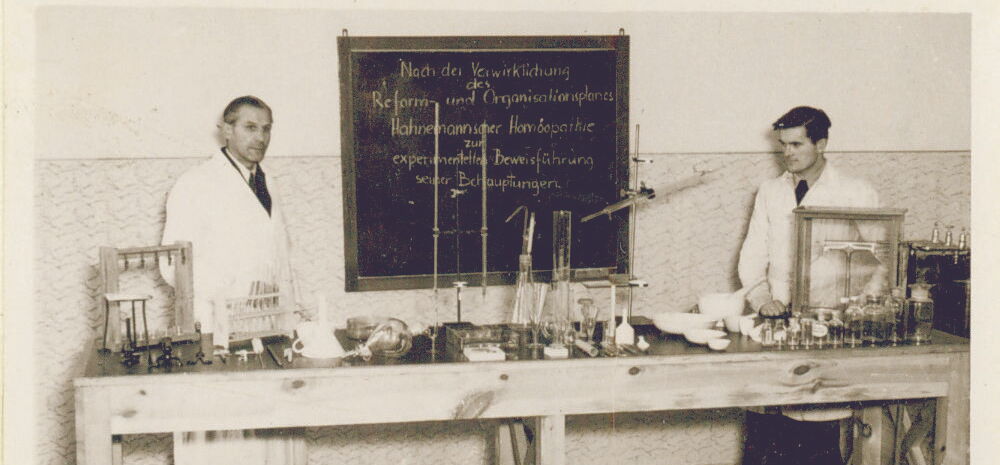Projekte
Bereits der Stifter Robert Bosch hatte bei dem Erwerb des Hahnemann-Nachlasses und der Beteiligung am Aufbau einer Paracelsus-Bibliothek die Absicht, die Homöopathie und andere Verfahren, die heute der Komplementärmedizin zugerechnet werden, in den Dialog mit der Schulmedizin zu bringen. Dieser Grundgedanke eines Pluralismus in der Medizin kennzeichnet auch die historische Forschung des IGM, die sich nicht mehr allein auf die Homöopathiegeschichte beschränkt.
Traditionelle Medizin in Deutschland: Begriffsbestimmung als Grundlage für die Positionierung Deutschlands in der Traditional Medicine Strategy der Weltgesundheitsorganisation
In Anerkennung der Bedeutung der traditionellen Medizin in verschiedenen Kulturen weltweit hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits in den 1970er Jahren ihre Traditional Medicine Strategy ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Praktiken der traditionellen Medizin zu dokumentieren und zu verstehen sowie Wege zu finden, sie in heutige Gesundheitssysteme zu integrieren. Neben der Bewahrung und Achtung der kulturellen Traditionen ist die traditionelle Medizin außerdem in vielen Regionen für einen großen Teil der Bevölkerung die erste oder einzige Möglichkeit der Gesundheitsversorgung. Vor dem Hintergrund weltweiter Herausforderungen des Gesundheitssystems hat die WHO daher darauf aufmerksam gemacht, dass diese nicht nur mit überwiegend westlich geprägter Biomedizin gelöst werden können.
Traditionelle Medizin wird durch die WHO definiert als „sum total of the knowledge, skill, and practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness“. In Deutschland findet der Terminus „Traditionelle Medizin“ nur selten bis gar keine Verwendung. Hierfür sind vor allem zwei Barrieren erkennbar. Erstens fehlt eine Definition von traditioneller Medizin in Deutschland und zweitens findet trotz wachsender Evidenzbasierung noch immer eine pauschale Ablehnung traditioneller Verfahren in der akademischen Medizin statt. In diesem Projekt soll daher zunächst systematisch untersucht werden, wie der von der WHO geprägte Terminus für den deutschsprachigen Raum definiert werden kann. Dabei soll auch herausgearbeitet werden, an welchen Stellen hinsichtlich des Terminus „Traditionelle Medizin“ Weichen gestellt wurden bzw. weshalb sich dieser in der Debatte zwischen konventionellen und komplementären Therapien nicht etablieren konnte. In einem weiteren Schritt wird nach der Bedeutung traditioneller Medizin für das medizinische System in Deutschland gefragt.
Das Ziel des Projektes ist es, die Grundlage für eine Positionierung Deutschlands in der Traditional Medicine Strategy der WHO zu schaffen und darüber hinaus weitere Arbeiten zur Umsetzung der durch die WHO geforderten integrativen Medizin anzuregen.
Bei dem Projekt handelt es sich um das erste BHC-Kooperationsprojekt, das gemeinsam vom IGM und dem Robert Centrum für Integrative Medizin und Gesundheit (RBIM, Leitung: Prof. Dr. Holger Cramer) durchgeführt wird. Das Ziel des Projektes ist es, die Grundlage für eine Positionierung Deutschlands in der Traditional Medicine Strategy der WHO zu schaffen und darüber hinaus weitere Arbeiten zur Umsetzung der durch die WHO geforderten integrativen Medizin anzuregen.
(Bearbeiter: Florian Barth, M. A., Marius Maile, M. A.)
Im Rahmen dieses Projekts wurde die Entwicklung der digitalen Edition am Beispiel der Transkription des französischen Krankenjournals DF 5 forciert, insbesondere in der TEI-Kodierung, der eXist-Datenbank und der Gestaltung der Website. Es wurde ein Workflow zur semiautomatischen Konvertierung der Transkriptions-Struktur in das TEI-Format erarbeitet, der sich in Zukunft auf die transkribierten Krankenjournale übertragen lässt. Basierend auf dem SADE-Framework entstand eine Website, die eine synoptische Ansicht von Faksimile und verschiedenen Textvarianten sowie eine facettierte Suche umfasst. Patienten-Entitäten können so im Text nachverfolgt und mit der von Hahnemann vorgenommenen Medikation erschlossen werden. Darüber hinaus wurde eine dynamische Darstellung der Patientenwohnorte sowie die Modellierung eines Patientennetzwerks mitsamt der dazugehörigen Normdaten entwickelt. Die digitale Edition bietet nun im Vergleich zur Printversion einen deutlich offeneren Zugang zu Hahnemanns Krankenjournalen.
Sie ist über https://www.hahnemann-edition.de erreichbar.
(Bearbeiter: Dr. med. Michael Teut, Prof. Dr. phil. Martin Dinges, Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Robert Jütte)
Religion und Medizin stehen seit alten Zeiten in einer durchaus ambivalenten Beziehung. Grundsätzlicher wurde die Differenz zwischen Heilkunde und Seelsorge im 19. Jahrhundert, als sich Theologie und Medizin als Wissenschaftsdisziplinen ausdifferenziert hatten, die ihre Gegenstände und Verfahren geradezu gegensätzlich definierten. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen im Gesundheitswesen ist ein frischer Blick auf religiös inspirierte Formen der Heilung höchst aufschlussreich – nicht nur, um diese zu analysieren, sondern geradezu als Lackmustest für unser Verhältnis zu den spezifischen Denkweisen der modernen Wissenschaft und Medizin.
Die Tagungsbeiträge sind als Beiheft Nr. 71 der Zeitschrift „Medizin, Gesellschaft und Geschichte" erschienen.
(Bearbeiter: Dr. phil. Daniel Walther)
Die wenigen, denen Gustav Jäger (1832–1917) heutzutage bekannt ist, bringen mit dem Namen die Bemühungen Jägers um eine gesundheitsfördernde Bekleidung in Verbindung. Unter dem Namen „Normalkleidung“ vermarktete er ab 1880 aus tierischer Wolle gefertigte Textilien, die dem Körper bei der Ausscheidung sogenannter Krankheitsstoffe und der Wärmeregulierung helfen und ihn abhärten sollten. Gänzlich in Vergessenheit geraten sind dagegen Jägers Verdienste um die Homöopathie. Er war überzeugt, mit Hilfe der von ihm entwickelten Neuralanalyse sowie des physiologischen Antagonismus die Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln nachweisen zu können.
Das Projekt geht den beiden Fragen nach, warum sich Jäger – eigentlich Zoologe, später kommerziell erfolgreicher Lebensreformer – überhaupt mit der Homöopathie beschäftigte und wie die Homöopathen seinerzeit auf seine Entdeckungen reagierten. Aufschluss sollen darüber die Periodika „Homöopathische Monatsblätter“, „Leipziger Populäre Zeitschrift für Homöopathie“ und „Allgemeine Homöopathische Zeitung“ im Zeitraum von 1879 bis 1917 geben. Zusätzlich werden zwei Schriften Jägers über die Homöopathie ausgewertet und die von ihm herausgegebene „Zeitschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre“ durchgesehen.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Ein Aufsatz ist im Jahrbuch „Medizin, Gesellschaft und Geschichte" Band 37 erschienen.
(Bearbeiterin: Marisa Chironna)
In dem bereits 2016 erschienenen Werk „Medici o ciarlatani?“ wurde die Entwicklung der Homöopathie im Königreich der beiden Sizilien zwischen 1822 und 1860 untersucht. In diesem Nachfolgeprojekt wird die Studie geographisch auf die Entwicklung der Homöopathie im italienischen Kirchenstaat für denselben Zeitraum ausgedehnt. Geplant ist, personelle und institutionelle Faktoren zu berücksichtigen. Eigene Kapitel werden sich sowohl praktizierenden Ärzten als auch Laien wie auch der Haltung der Universitäten zur Homöopathie widmen. Neben der Rolle der Cholera für die Ausbreitung der Homöopathie, spielt die Einstellung der Päpste zu dieser komplementären Heilweise eine Rolle. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Untersuchung der Tätigkeit des homöopathischen Arztes Johann Wilhelm Wahle (1794-1853), der dem direkten Schülerkreis von Samuel Hahnemann (1755-1843) angehörte. Wahle praktizierte seit 1840 in Rom und geriet dort aus bisher unbekannten Gründen mit den Behörden in Konflikt. Der Nachlass Wahles, der im Homöopathie-Archiv aufbewahrt wird, ist hierfür eine grundlegende Quelle. Die an ihn gerichteten Briefe versprechen Aufschlüsse über die von ihm betreuten Patienten sowie seine beruflichen Netzwerke.
(Bearbeiter: Dr. phil. Joel Piqué Buisan)
Das Dissertationsprojekt befasst sich mit sozialen und wissenschaftlichen Konstruktionsprozessen der Homöopathie in Katalonien von 1890 bis 1924. Jenseits der üblichen Ideen- und Rezeptionsgeschichtlichen Narrative stehen die enge Verknüpfung von Laborforschung, Krankenhaus und ärztlicher Wissenschaftsrhetorik im Fokus. Diese werden in einem regionalhistorischen Ansatz präzise herausgearbeitet. Eine besondere Beachtung wird zudem den Apotheken und Apothekern als Agenten der kommerziellen Legitimierung der Homöopathie in Barcelona geschenkt. Ebenso spielen Aspekte der Arzneimittelimporte und der eigenen Produktion der Apotheken sowie Werbung und Kooperationen auf dem lokalen Markt eine Rolle. Neben der in spanischer Sprache verfassten und 2018 mit der Höchstnote bewerteten Dissertation, erscheint eine englische Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in der Zeitschrift MedGG.
(Bearbeiter: Prof. Dr. phil. Florian Mildenberger)
Ursprünglich als Nachfolgeprojekt zur Untersuchung über die Geschichte der homöopathischen Ärzte im Nationalsozialismus konzipiert, änderten sich die Prämissen durch das Desinteresse der Heilpraktikerverbände an einer Aufarbeitung der eigenen Geschichte vor 1945. Daraufhin wurde entschieden, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass diejenigen deutschsprachigen Gebiete untersucht werden sollten, in denen die Ausübung der Laienheilkunde lange Zeit strikt verboten gewesen war. Dahinter stand die Idee, dass in diesen Territorien sowohl Heilkundige als auch Patienten einem erheblich höheren Professionalisierungsdruck unterlagen als im zweiten deutschen Kaiserreich, wo Kurierfreiheit herrschte. Infolgedessen standen die deutschsprachigen Gebiete des historischen Königreiches Böhmen und das Territorium des nach 1918 entstandenen Österreich im Zentrum der Betrachtung. Nur in der kurzen Phase des Nationalsozialismus 1938/39 bis 1945 gab es hier eine offiziell zugelassene Laienheilkunde. Um darüber hinaus nachvollziehen zu können, wie sich Laienheilkundige positionierten, wenn die zuvor gewährte Kurierfreiheit plötzlich entfiel, wurden noch die Provinz Posen und das „Reichsland“ Elsass-Lothringen in die Untersuchung aufgenommen. Nach 1918 war in beiden Gebieten die Laienheilkunde verboten worden, überdauerte jedoch und wurde 1939/40 wieder legalisiert. Schließlich wurde der Vollständigkeit halber auch noch das von französischen und deutschen Sprach- und Rechtstraditionen gleichermaßen geprägte Großherzogtum Luxemburg in die Untersuchung einbezogen. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden in einer Monographie und einigen Aufsätzen 2018 publiziert werden.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Die Ergebnisse sind in Band 69 der Beiheft-Reihe von „Medizin, Gesellschaft und Geschichte" erschienen.
(Postdoc-Projekt, Bearbeiter: Dr. phil. Daniel Walther)
Die medizinhistorische und -soziologische Forschung hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, warum Patienten der konventionellen Medizin den Rücken kehren und alternativ- bzw. komplementärmedizinische Praktiken wie die Homöopathie in Anspruch nehmen. Seltener dagegen rückten die individuellen Beweggründe des medizinischen Personals (Ärzte, Heilpraktiker, Krankenschwestern und -pfleger) ins Blickfeld. Gegenstand solcher Untersuchungen waren vornehmlich die Haltung von Ärzten gegenüber der Homöopathie oder ihre Stellung innerhalb des Gesundheits- und Krankenversicherungssystems.
Im Rahmen des Postdoc-Projekts soll nun zum einen der Frage nachgegangen werden, welches spezifische Selbst- und Gesundheitsverständnis homöopathische Ärzte und Heilpraktiker ihrer medizinischen Praxis zugrunde legen. Zum anderen sind die persönlichen Motive von Interesse, die besonders Ärzte dazu veranlasst haben, ihr im Studium erlerntes naturwissenschaftlich-kausalanalytisches Denken zu hinterfragen und sich teilweise oder ganz von der Schulmedizin abzuwenden. Aufschluss darüber gewähren die insgesamt 26 autobiographischen Berichte, die dem IGM nach einem Aufruf in der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung (AHZ) von ärztlichen und nichtärztlichen Homöopathen aus dem ganzen Bundesgebiet zugeschickt worden sind. Herangezogen werden zusätzlich 15 einseitige Kurzberichte von englischen Homöopathen, die in der Zeitschrift Homeopathy & Health unter der Rubrik „Why I became a Homeopath“ publiziert wurden. Dieses zweite Sample ermöglicht einen transnationalen Blick auf die individuellen Beweggründe von Ärzten und Heilpraktikern, die Homöopathie in ihrer Praxis anzuwenden. Der bilaterale Vergleich lässt wiederum Rückschlüsse zu, ob die Hinwendung zur Alternativ- und Komplementärmedizin als aktive Kritik am ökonomisierten Gesundheitswesen zu verstehen und damit eine Antwort auf dessen Missstände ist oder ob sie primär persönlichen bzw. berufsethischen Reflexionen geschuldet ist.
Nachdem die Analyse der deutsch- und englischsprachigen Ärztebiographien die individuellen Motive und deren Rückkopplung an gegenwärtige, übergeordnete soziokulturelle und politökonomische Prozesse offengelegt hat, können die Ergebnisse auf diachroner Ebene verglichen und historiographisch eingeordnet werden. Als Quelle bieten sich die biographischen Angaben an, die Fritz Schroers in seinem Lexikon deutschsprachiger Homöopathen zusammengetragen hat. Ebenso werden einzelne ausgewählte Autobiographien konsultiert, um Näheres über die spezifische Motivik in Erfahrung zu bringen, die Ärzte im 19. und 20. Jahrhundert bewogen hat, trotz aller Widerstände der akademischen und später der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin den Rücken zu kehren.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Ein Aufsatz ist im Jahrbuch Medizin, Gesellschaft und Geschichte Band 36 erschienen.
(Bearbeiter: PD Dr. phil. Carlos Watzka)
Ziel des Postdoc-Vorhabens ist es, Bedeutung und Wirksamkeit von diätetischen Wissensbeständen zum Themenfeld der Affekte in den Praktiken der geistlichen Medizin katholischer Ausprägung in der Frühen Neuzeit untersuchen. Hierbei bilden der Zeitraum vom späten 16. bis zum späten 18. Jahrhundert den zeitlichen und Bayern sowie Österreich den räumlichen Rahmen. Unter „geistlicher Medizin“ wird dabei, in einem weiten Begriffsverständnis, die Gesamtheit jener Diskurse und Praktiken verstanden, die mit Bezug auf Phänomene von Gesundheit und Krankheit von Personen geistlichen Standes bzw. kirchlichen Institutionen getragen werden.
Obwohl die Geschichte der „alternativen“ bzw. „komplementären“ Medizin ebenso wie das Thema der vormodernen Diätetik in den letzten Jahrzehnten vermehrt wissenschaftliche Aufmerksamkeit gefunden haben, ist der Forschungsstand zu dieser spezifischen Fragestellung bislang noch gering.
Das Forschungsprojekt geht von folgenden Thesen aus: Neben genuin theologischen Konzepten – hier ist vor allem die Bedeutung der ‚Leidenschaften‘ in den Lehren über die ‚Todsünden‘ zu beachten – prägten auch die fachmedizinischen Lehren, weiter aber populäre – und nicht zuletzt ‚magische‘ – Vorstellungen die einschlägigen Wissensbestände und die damit verbundenen Praktiken des katholischen Klerus. Besondere praktische Bedeutung kam dem Umgang mit Affekten in intensiven Krisenerfahrungen zu, mit welchen Geistliche berufsbedingt regelmäßig konfrontiert waren, insbesondere der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden sowie seelsorgliche Betreuung von Hinterbliebenen.
Diese Fragestellungen werden anhand ausgewählter Quellenbestände untersucht; zum einen sollen ‚Seelentrostbücher‘, Andachtsbücher, Rezeptsammlungen u.ä. analysiert werden, also Handlungsanleitungen für und/oder von Geistlichen, zum anderen Quellen, in welchen konkret realisierte Handlungen einen (wenn auch nicht ‚objektiven‘) Niederschlag gefunden haben, etwa ‚Mirakelbücher‘, als schriftliche Darstellungen zu angenommenen, heilsamen göttlichen Wirken an ‚Gnadenorten‘, thematisch relevante Berichte und Korrespondenzen von Geistlichen bzw. von ihnen betreuten Personen, aber auch einschlägige Bildquellen und – soweit vorhanden – Akten kirchlicher und weltlicher Behörden.
(Bearbeiterin: Dr. phil. Carol-Ann Galego)
Anfang September 2017 begann Dr. Galego ihre Postdoc-Forschung im IGM, mit der sie ihr Interesse an der homöopathischen Behandlung von Epidemien und deren politischer Bedeutung weiter verfolgt. Während ihre Doktorarbeit auf die früheren Jahre der Homöopathie fokussierte, forscht sie jetzt über die Homöopathie zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Blick auf Entwicklungen in Bakteriologie und Keimtheorie und deren Einfluss auf Homöopathen in Deutschland, Großbritannien und den USA. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Wie unterschied sich das homöopathische Verständnis der Ätiologie von den Lehren der Keimtheorie? Wie unterschied sich die Wahrnehmung der körperlichen Widerstandskraft von den modernen Theorien der Immunität als Abwehr? Während Samuel Hahnemanns verhältnismäßig nuanciertes Verständnis der Übertragung von ansteckenden Krankheiten manchmal als Prototyp der späteren Entwicklungen in der Keimtheorie und der Immunologie betrachtet wird, bieten andere Aspekte seiner Krankheitslehre interessante Kontrastpunkte zu diesen Entwicklungen, vor allem das Beharren auf der Immaterialität der Krankheit und das Verständnis der inhärenten Interkonnektivität und Empfänglichkeit lebender Organismen.
(Bearbeiter: Dr. phil. Daniel Walther)
Das Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung besitzt wertvolle Bestände, die über die Tätigkeit homöopathischer Laienvereine in der Zeit seit 1870 bis in die Gegenwart Aufschluss geben können: vereinsbezogene Protokoll- und Kassenbücher, Mitgliederverzeichnisse, Jahresberichte, spezifische Zeitungsartikel. Weitere Quellen dieses Promotionsvorhabens sind Zeitzeugenaussagen und Erlebnisberichte. Daneben stellen externe, nicht direkt den Vereinen zugeschriebene Quellen wie Zeitschriftenartikel der „Homöopathischen Monatsblätter“, der „Leipziger Populären“ oder Artikel des „Medicinischen Correspondenzblatts des Württembergischen Ärztlichen Vereins“ eine weitere Möglichkeit dar, tieferen Einblick in die Strukturen der Vereins- und der übergeordneten Verbandstätigkeit zu erlangen.
Zentrale Fragen des Projekts sind einerseits, wie sich die Vereine im Zeitraum der Untersuchung entwickelten und wie sich der Einfluss der verschiedenen politischen Systeme auf die Vereinsarbeit auswirkte. Andererseits gilt es zu klären, welchen Einfluss die Vereine namentlich auf die Gesundheitspolitik hatten und haben und inwieweit die Laienvereine als Reaktion auf die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmende Entmündigung des Patienten gewertet werden kann. Die Vereine boten und bieten teils noch heute ein vielfältiges Spektrum an gesundheitlicher Aufklärung, nicht nur im Bereich der Homöopathie. Gerade öffentliche Vorträge über Themen von allgemeinem Interesse, Vergünstigungen und Rabatte für Mitglieder etwa beim Besuch von Badeanstalten oder homöopathischen Ärzten, günstigeren oder in manchen Fällen sogar kostenlosen Zugang zu homöopathischen Medikamenten durch Unterhaltung einer Vereinsapotheke waren vielfältige Anziehungspunkte. Auch wurden von den Vereinen Bibliotheken angelegt, die neben allgemeinverständlicher Literatur über die Homöopathie auch andere Ratgeber in Sachen Gesundheit umfassten. Die Inanspruchnahme solcher Angebote konnten und können dazu beitragen, dass der Kranke durch medizinische Bildung und Aufklärung in gewisser Weise die Kontrolle über seinen eigenen Körper, seine Gesundheit und somit seine Mündigkeit zumindest teilweise zurück erlangt.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Die Ergebnisse sind in Band 67 der Beiheft-Reihe von „Medizin, Gesellschaft und Geschichte" erschienen.
(Bearbeiterin: Dr. phil. Marion Baschin)
Zum 200. Geburtstag von Wilhelm Schüßler (1821–1898) erscheint im vorliegenden Band ein seltener Schatz für die Geschichte der von ihm begründeten Heilweise Biochemie: Erstmals werden etwa 150 Briefe von Schüßler an seine Apotheker Albert Marggraf (1809–1880) und William Steinmetz (1855–1908) veröffentlicht. Diese Briefe befinden sich seit 2014 im Besitz der Firma Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG in Rheda-Wiedenbrück.
In den Briefen und Postkarten von 1867 bis 1882 wird nicht nur Schüßlers Arbeit deutlich. Man lernt ihn als experimentierfreudigen und neugierigen Arzt kennen. Auch seine Freundschaft zu Marggraf kann nun besser betrachtet werden. Bei dessen Tod im November 1880 kondolierte Schüßler mit der Bemerkung, dass dieser ihm „etwa 20 Jahre Arzneien geliefert“ habe. Der Apotheker zählte zu den eifrigsten Förderern Schüßlers in den ansonsten ihm eher kritisch gegenüberstehenden homöopathischen Kreisen.
Elf Abbildungen von Originalschreiben ergänzen dieses außergewöhnliche kulturelle und historische Erbe, das eine gute Ergänzung zur Erforschung der Biochemie nach Schüßler liefert.
Die Arbeit ist in Band 29 der Reihe „Quellen- und Studien zur Homöopathiegeschichte" erschienen.
(Bearbeiterin: Dr. phil. Marion Baschin)
Im Jahr 1874 veröffentlichte Wilhelm Heinrich Schüßler erstmals seine „Abgekürzte Therapie“ als eigene Schrift. Vor seinem Tod 1898 redigierte er die 25. Auflage des Werkes. Die von Schüßler begründete Biochemie und die nach ihm benannten „Schüßler-Salze“ erfreuen sich auch heute einer großen Beliebtheit.
Das Projekt knüpft an die 2015 abgeschlossene Arbeit zur Selbstmedikation mit Schüßler-Salzen an. Die umfangreichen Materialien, die aus zahlreichen Archiven und Bibliotheken, unter anderem in Oldenburg und Leipzig, zusammengetragen wurden, sollen nun für eine Publikation ausgewertet und aufbereitet werden. Im Mittelpunkt stehen die von Schüßler als Medikamente verwendeten zwölf Salze, besonders deren Herstellung, Verkauf und Verbreitung.
Während der Entwicklung seiner biochemischen Heilmethode verwendete Schüßler unterschiedliche Potenzen und machte bezüglich der Einnahme verschiedene Aussagen. Seit 1892 empfahl er ausschließlich die heute zum Standard gewordenen Potenzen D 6 und D 12. Die Bezugsquellen Schüßlers – Albert Marggraf in Leipzig und die Apotheken Zahn und Seeger in Stuttgart sowie Virgil Mayer in Bad Cannstatt - und weitere Hersteller der „Schüßler-Salze“ werden ebenso betrachtet. Dabei konkurrierten 1905 etwa sieben große Apotheken um einen erfolgreichen Absatz der freiverkäuflichen Arzneimittel. Zahlreiche kleinere Apotheken und Fabriken entstanden ab 1920.
Die Arbeit ist in Band 25 der Reihe Quellen- und Studien zur Homöopathiegeschichte erschienen.
(Bearbeiterin: Dr. phil. Marion Baschin)
Was ist Isopathie? Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist nicht einfach. Der Leipziger Tierarzt Johann Wilhelm Lux (1773–1849) führte als einer der ersten die homöopathischen Prinzipien bei der Behandlung von Tieren ein. Er veröffentlichte 1833 aber auch sein Werk „Die Isopathik der Contagionen“, mit dem er die Isopathie als ein der Homöopathie überlegenes Heilsystem vorstellte. Darin führte Lux den Gedanken, Krankheiten nach dem Prinzip von „Gleichem durch Gleiches“ (Aequalia Aequalibus curentur) zu behandeln, weiter aus, indem er zugleich formulierte: „Alle ansteckenden Krankheiten tragen in ihrem eigenen Ansteckungsstoffe das Mittel zu ihrer Heilung.“ Die Ideen von Lux stießen vor allem bei dem Hahnemann-Schüler Gustav Groß (1794–1847) auf Zustimmung. Mit der Überlegung, dass die Isopathie die „ideale Homöopathie“ sei, riefen jedoch beide große Kritik innerhalb der homöopathischen Ärzteschaft hervor und entfachten eine lebhafte Diskussion darüber, ob es eine wirkliche Behandlung nach dem Gleichheitsprinzip geben könne. Letztendlich wurden die Isopathie beziehungsweise vor allem deren Mittel der Homöopathie ein- oder untergeordnet. Dennoch flammte die Debatte um dieses Therapiemethode immer wieder auf. Heutzutage versteht man unter „Isopathie“ häufig verkürzend eine Behandlung, bei der Krankheitserreger zu Heilmittel verarbeitet werden und verbindet diese Idee vor allem mit dem Biologen Günter Enderlein (1872–1968).
Die Idee, "Gleiches mit Gleichem" zu heilen forderte also immer wieder Homöopathie und „Schulmedizin“ heraus. Die Isopathie hat sich demnach auch aus der Homöopathie heraus entwickelt und steht mit dieser in einem steten Wechselverhältnis. Wie sind jedoch die Entwicklung der Isopathie und ihr Verhältnis zur Homöopathie und „Schulmedizin“ im Einzelnen zu sehen? Welche Bedeutung und Auswirkung haben die Isopathie, die von ihr verwendeten Wirkstoffe und die durch ihre Hauptvertreter ausgelösten Debatten in der Heilkunde?
Die Beantwortung dieser Fragen soll in diesem Drittmittelprojekt vorgenommen werden. Als Hauptquellen dienen die Veröffentlichungen von Johann Wilhelm Lux sowie weiteren Vertretern dieses Heilprinzips, entsprechende Artikel in homöopathischen Zeitschriften, wie der AHZ oder der ZBV, und weitere Publikationen zur Isopathie aus der Zeit von 1830 bis um 1950.
Die Arbeit ist in Band 23 der Reihe „Quellen- und Studien zur Homöopathiegeschichte" erschienen.
(Bearbeiter: Prof. Dr. phil. Florian Mildenberger)
Ab 1933 wurde seitens der nationalsozialistischen Machthaber die »Neue Deutsche Heilkunde« als Konzept der Alternativmedizin entwickelt. Der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte war dabei ein wichtiger Akteur. Kollegen, die gegen die Nazis opponierten, wurden aus den Reihen des »Zentralvereins« ausgestoßen oder zumindest nicht unterstützt. Die überwiegende Mehrheit der homöopathischen Ärzte passte sich den ideologischen und medizinischen Vorgaben des NS-Regimes an. Dennoch erreichte der »Zentralverein« im Gegenzug keine allgemeine Anerkennung für die Homöopathie in der offiziellen NS-Politik.
Florian G. Mildenberger weist in seiner Studie nach, dass der Verband und seine Mitglieder nicht, wie in der Vergangenheit oft behauptet, zu den Medizinern gehörten, die an den in Konzentrationslagern begangenen verbrecherischen Menschenversuchen beteiligt waren. Diese Verbrechen wurden ebenso wie das Interesse führender Nazis wie Heinrich Himmler oder Rudolf Heß an naturheilkundlichen Zusammenhängen häufig aus Unkenntnis von Zeitzeugen und Historikern mit der Homöopathie in Verbindung gebracht.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen und eine Publikation liegt vor.
(Bearbeiterin: Dr. phil. Marion Baschin)
Im Jahr 1874 veröffentlichte Wilhelm Heinrich Schüßler erstmals seine „Abgekürzte Therapie“ als eigene Schrift. Vor seinem Tod 1898 redigierte er die 25. Auflage des Werkes. Die von Schüßler begründete Biochemie und die nach ihm benannten „Schüßler-Salze“ erfreuen sich auch heute einer großen Beliebtheit. Insbesondere bei leichteren Beschwerden werden die Mittel im Rahmen der Selbstmedikation verwendet.
Heute sind die „Schüßler-Salze“ zwar nicht rezeptpflichtig, aber man kann sie nur in Apotheken erwerben. Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein konnten die biochemischen Mittel aber auch durch Vereine abgegeben werden, da deren Status als Arzneimittel noch nicht abschließend geklärt war. Ähnlich wie in der Homöopathie war auch für die Biochemie nach Schüßler ein heftiger Kampf darum entstanden, wer dazu berechtigt war, die Mittel herzustellen und abzugeben.
Das Projekt fokussiert in erster Linie auf die „Schüßler-Salze“ an sich. Gerade in der Frühzeit der biochemischen Bewegung soll die Rolle der Mittel in Therapie und Selbstbehandlung untersucht werden. Das Interesse gilt daher neben dem Begründer der Heilmethode auch biochemischen Apotheken und Vereinen. Da Unterlagen zu Schüßler und seiner Biochemie kaum in einer Bibliothek oder einem Archiv systematisch gesammelt wurden, besteht ein wichtiger Teil des Projekts zudem in der Suche nach geeigneten Quellen und aussagekräftigen Dokumenten.
Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen.
(Bearbeiterin: Dr. phil. Marion Baschin)
Wie kam es dazu, dass sich die Homöopathie als eine so beliebte Möglichkeit der Selbsthilfe etablieren konnte? Dieser Frage stellt sich Marion Baschin im hier vorliegenden Werk, das erstmals die Tradition der Eigenbehandlung mit homöopathischen Arzneien vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts darstellt. Zu den Faktoren, die die Selbstmedikation mit Homöopathika gefördert haben, gehören die Grundlagen der Lehre Hahnemanns selbst: Die Homöopathie galt als einfache, sanfte und kostengünstige Heilmethode. Der Mangel an homöopathischen Ärzten zwang Interessierte überdies zu einer Selbsttherapie, während gleichzeitig die Erfolge der Lehre Hahnemanns bei der Behandlung der Cholera und anderer Krankheiten deren Bekanntheit steigerten. Laienratgeber als Anleitungen zur Selbsthilfe waren weit verbreitet. Vielerorts angebotene Haus- und Taschenapotheken sowie gegenseitige Information und Hilfestellungen in Laienvereinen begünstigten die Selbsthilfe zusätzlich. Auch die von Dr. Wilhelm Schüßler entwickelte Biochemie und die Selbstbehandlung mit den „Schüßler-Salzen“ werden in einem Exkurs berücksichtigt. Damit erschließt diese sozial- und medizinhistorische Studie vielfältige Aspekte der Selbstmedikation mit homöopathischen Mitteln.